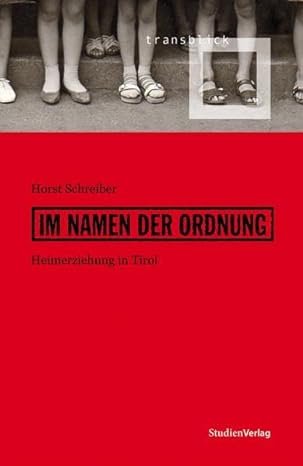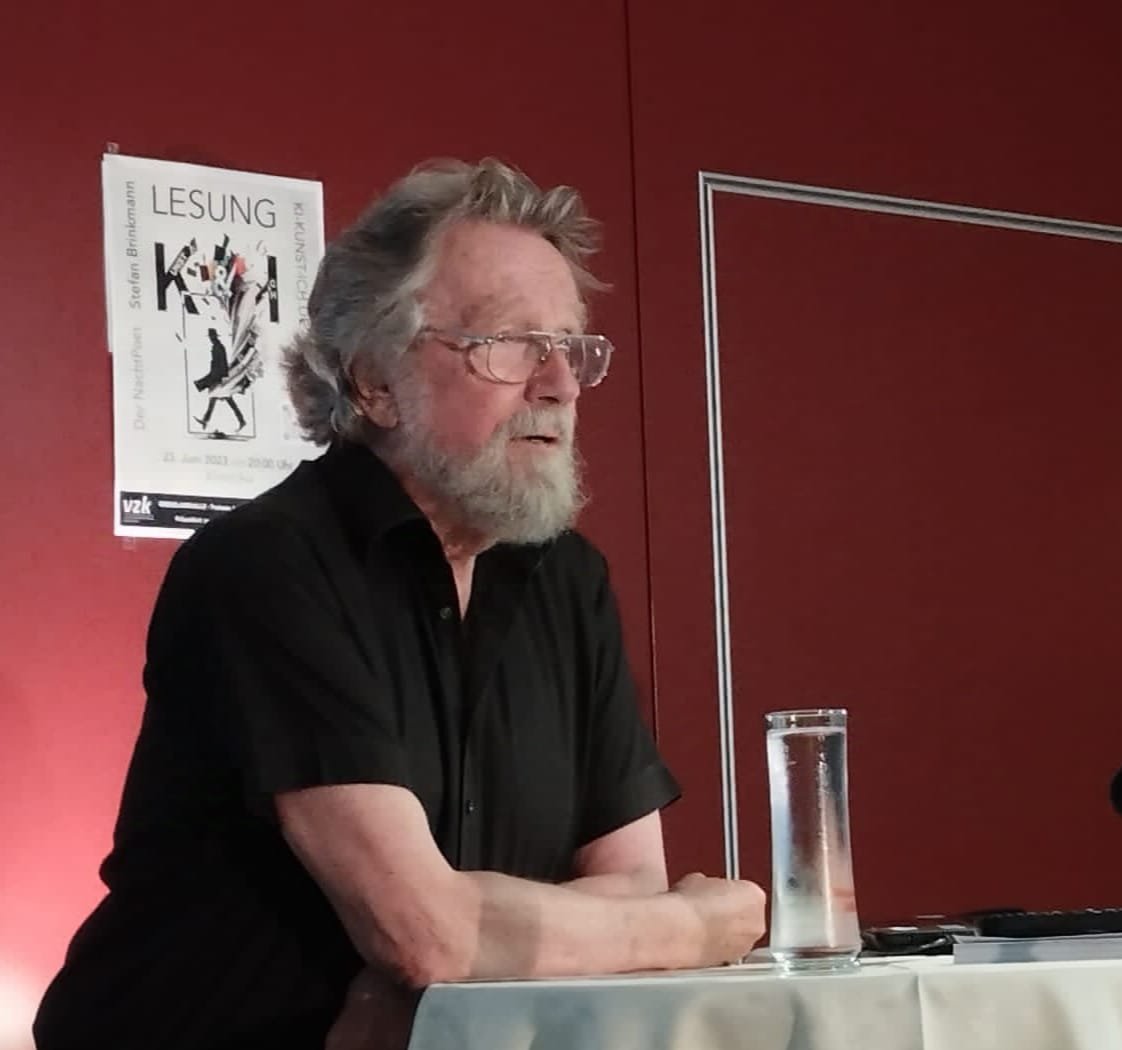“Mauern überall”
Vor 44 Jahren Missbrauch aufgedeckt
Land Tirol ehrt am hohen Frauentag 2024
Brigitte Brinkmann-Wanker für ihre Zivilcourage
Das Land Tirol ehrte am 15.08.2024 unsere Schriftführerin und Collagen-Künstlerin Brigitte Brinkmann-Wanker mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol. Wir gratulieren dieser außergewöhnlichen und mutigen Frau für diese so wichtige Anerkennung, die ihr nach 44 Jahren nun endlich zuteil wird.
Die wahre Bedeutung dieser Ehrung wird erst deutlich, wenn man die ganze Geschichte kennt. Im Rahmen der Ehrung wurde sie leider nicht deutlich. Ihr Grund findet sich nur in der Liste der Geehrten als:
Das wird der Geschichte von Zivilcourage und Verleumdung, systematischer Misshandlung und Vertuschung, Aufklärung und Aufarbeitung, nicht gerecht.
Hier eine Zusammenfassung der Ereignisse.
1980: Das Grauen
1980 wollte die damals 22-jährige Brigitte Wanker mit ihrer handwerklichen Ausbildung bei der Freizeitgestaltung der geistig behinderten Kinder im St. Josef Institut mithelfen. Stattdessen wurde sie als unausgebildete Pflegerin eingestellt, zur Betreuung von einer Bubengruppe im schulpflichtigen Alter.
Die menschenverachtende Grausamkeit, der sie dort Zeuge wurde, ist kaum zu ertragen und noch schwerer in Worte zu fassen. Brigitte schaffte es trotzdem, in ihrem eindrücklichen Tagebuch “Mauern überall”. Hier nur ein Beispiel:
Auszug aus “Mauern überall”: Mittagessen am zweiten Arbeitstag: Wolfgang [Name geändert] weigert sich, den Rest der Mahlzeit aufzuessen. Die Schwester stopft ihm alles in den Mund. Er schluckt nicht, sie droht: "Wir gehen ins Bad." Gebet, alle stehen auf, Wolfgang hat noch immer den Mund voll. Die Schwester zerrt ihn ins Bad. Ich muss inzwischen mit den anderen Kindern geschlossen zum Klo gehen. Wir hören im Nebenraum die Schwester brüllen, zuschlagen und Wolfgang schreien. Die Kinder halten sich die Ohren zu, wir hören die Szene fassungslos mit an. Auf meine Frage erzählen sie mir, dass so etwas öfters vorkommt. Wolfgang kommt verheult und mit einem blutigen Striemen auf der Wange aus dem Bad. Er berichtet mir zögernd, dass er zuerst kalt geduscht und dann mit dem Hosenträger geschlagen worden war.
[…]
Mittagessen, ca. ein Monat später: Ich hänge im Bad Wäsche auf. Die Schwester kommt mit Wolfgang, der wieder den Rest der Mahlzeit (Gulasch) nicht essen will. Ich soll ihn zwingen, alles aufzuessen. Er weint, schaut mich verzagt an und erbricht. Ich lasse alles fallen, schnappe mir einen Fetzen von der Schmutzwäsche und wische mit ihm gemeinsam auf. Die Schwester kommt zurück, sieht den Rest auf dem Teller und befiehlt ihm, sich nackt auszuziehen. Bevor sie das Bad verlässt, sagt sie: "Ich komme gleich wieder" Wolfgang beginnt sich auszukleiden; zwischendurch versucht er immer wieder, einen Bissen hinunterzuwürgen. Die Schwester kommt, schreit auf ihn ein, fordert ihn auf, sich in die Badewanne zu stellen. Sie duscht ihn kalt ab, Wolfgang versucht mit der Hand Wasser in den Mund zu schöpfen, um das Essen leichter schlucken zu können. Sie verbietet es ihm, und er wird kalt geduscht, bis er alles geschluckt hat. Ich stehe hilflos daneben, in mir ist alles blockiert. Ich zittere am ganzen Körper, verspüre unsagbaren Hass auf die Schwester und fühle mich allem so ausgeliefert.
Das ganze Tagebuch findet sich hier: Mauern überall
Mauern überall
Brigitte tat alles in ihrer Macht, um diesem Grauen entgegenzuwirken.
Brigitte Wanker: “Ich habe versucht, gegen mein Ausgeliefertsein in diesem festgefahrenen, unmenschlichen System anzukämpfen. Immer wieder musste ich feststellen, dass es für mich überhaupt keine Möglichkeit gab, etwas zu verändern.”
Sie suchte das Gespräch mit anderen Schwestern, der Heimleitung und Schwester Oberin. Sie stieß auf undurchdringliche Mauern.
Schwester Oberin: “Ich habe in meiner Kindheit mehr Schläge bekommen wie alle Kinder im Heim zusammen, und ich bin meinen Eltern dankbar dafür.”
Als ihr klar wurde, dass sie im Heim nichts erreichen kann, suchte sie die Hilfe der Behörden
Brigitte Wanker: „Ich habe mein Tagebuch genommen und bin damit zum Leiter des Innsbrucker Jugendamtes gegangen. Er hat mich aufgefordert, das Tagebuch zu verbrennen.“
Sie sei zu sensibel für den Beruf und solle kündigen, waren die Ratschläge, die ihr der Amtsleiter mit auf den Weg gab.
Brigitte Wanker: „Ich bin da raus und hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich hatte mir wirklich Hilfe erwartet. Ich war ja so naiv.“
Ans Licht gezerrt
Schließlich wandte Brigitte sich an die Presse. Das ORF schenkte ihr Gehör. Mit Hilfe der Fernsehsendung “teleobjektiv” deckten sie in diesem eindrucksvollen Bericht “Problemkinder” die strukturelle Gewalt im St. Josefs-Institut der Barmherzigen Schwestern in Mils, das damals “Pflegeanstalt für Geistesschwache” hieß. Die Journalisten Claus Gatterer und Kurt Langbein begannen zu recherchieren und drehten eine schockierende Reportage über die Zustände in Tiroler Kinderheimen.
Der öffentliche Aufschrei damals war groß. Nicht jedoch nur gegen die kirchliche Einrichtung, deren Missstände aufgezeigt wurden, oder die Behörden, welche diese unbehelligt ließen. Sondern geballt gegen jene, die das Unheil ans Licht zerrten. Vor allem gegen die junge Frau im Zentrum der Berichterstattung, Brigitte Wanker.
Brigitte Wanker: „Nach der Sendung war ich das Feindbild Nummer 1.“
In Zeitungen und Leserbriefen wird Brigitte als „Nestbeschmutzerin“ und „Lügnerin“ diffamiert. Der hochdekorierte Landeshauptmann-Stellvertreter Fritz Prior (ÖVP) zitierte die Skandal-Aufdeckerin in sein Büro.
Brigitte Wanker: „Das war das Ärgste. Der hat mir erklärt, dass er dafür sorgen wird, dass ich in Tirol nie wieder eine Stelle kriege.“
Der mächtige Landespolitiker sollte recht behalten. Wankers Ansuchen um einen Ausbildungsplatz in der Erzieherschule Pfaffenhofen wurde mit dem Satz quittiert, dass sie sich erst gar nicht zu bewerben brauche.
Die Kirche stand der Politik in ihrer Gangart gegen Kritiker um nichts nach.
Brigitte Wanker: „Bernhard Praxmarer, der Dekan von Hall, hat mich in einer Predigt als Kommunistin, linke Emanze und Lügnerin hingestellt. Mir wurde von allen Seiten klargemacht, dass ich in diesem Land nichts mehr verloren habe.“
Brigitte verließ Tirol, musste es verlassen, und ging nach Wien, wo sie die Erzieherschule absolvierte. Ihre Beziehung ging in die Brüche. Selbst in ihrer eigenen Familie wusste man nicht, wie man mit der als ‘Landesverräterin’ Abgestempelten umgehen sollte.
Erst zehn Jahre später, 1990, kehrte Wanker wieder in ihre Heimat zurück. „Aufs Land, wo mich keiner gekannt hat.“
Eine umfassende Studie aus dem Jahren 2020-2022 bringt die Auswirkungen von “Problemkinder” auf den Punkt:
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 353
Wenngleich sich bereits im vorangegangenen Jahrzehnt zunehmend Initiativen gebildet hatten, die gegen die geschlossene Heimerziehung auftraten, war der Beitrag das erste Format zu dieser Thematik mit einer derartigen Reichweite.
[…]
Festzuhalten ist jedoch, dass die Folgen drastisch waren – weniger für die Einrichtungen, die im Fokus standen, als für jene, die öffentlich über die dortigen Zustände gesprochen hatten. Während sich sowohl die Institutionen wie auch die kritisierend auftretenden Einzelpersonen in der Folge massiven Anfeindungen ausgesetzt sahen, waren es letztere, die in einer Schuldumkehr als Nestbeschmutzer*innen angesehen wurden.
Eine gerichtliches Verfahren wurde in den 80ern wegen Mangel an beweisen eingestellt. Für Brigitte Wanker und ihre Kollegin, die sich in “Problemkinder” zu Wort gemeldet hatten, fühle sich das Verfahren an, als säßen sie auf der Anklagebank.
KRONE Artikel vom 13.07.2013: Das gerichtliche Vorverfahren lief in Wankers Erinnerung wie ein Tribunal ab. „Ich wurde vier, fünf Stunden befragt wie eine Verbrecherin. Ich wurde regelrecht angebrüllt.“ Nach der Befragung erlitt sie einen Nervenzusammenbruch. Die prügelnde Klosterschwester wurde nicht verurteilt, durfte weiter Kinder betreuen.
Hort Schreiber - Im Namen der Ordnung
Für das St.-Josefs-Institut hatte es keine Konsequenzen, dass die beiden Frauen die Mauer des Schweigens durchbrochen hatten. Das gerichtliche Vorverfahren endete rasch mit einer Einstellung mangels an Beweisen. Bei den Vernehmungen bei der Staatsanwaltschaft fühlten sich die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen des Instituts wie die Angeklagten. Die Anstrengungen und Nachforschungen der Staatsanwaltschaft waren ohne Nachdruck.
2010: Aufarbeitung und Mitstreiter
Es dauerte 30 Jahre bis zum Beginn einer ernsthafte Aufarbeitung und Anerkennung der damaligen und teils fortlaufenden Missstände.
Eines der Opfer, das damalige Heimkind Erwin Aschenwald, wagte um 2010 den Gang an die Öffentlichkeit. Aschenwalds mutiges Auftreten und seine detaillierten Berichte trugen maßgeblich dazu bei, dass die Themen Missbrauch und Misshandlung in Heimen nicht nur in den Medien, sondern auch auf politischer Ebene ernsthaft aufgegriffen wurden.
Die Journalistin Brigitte Warenski von der Tiroler Tageszeitung kontaktierte daraufhin Brigitte Wanker und bat um ein Interview. Der daraus resultierende Artikel scheiterte am Widerstand der Schwester Oberin. Es folgte ein Radio-Interview bei OE1, das weite Kreise zog.
Held der Stunde: Horst Schreiber, anerkannter Historiker mit Forschungsschwerpunkt Regionalgeschichte von Tirol und Vorarlberg. Er begann schon früh mit der Aufarbeitung der “Heimskandale” und wurde durch das Radio-Interview auf Brigitte aufmerksam. Sein Buch “Im Namen der Ordnung” brachte endlich den Stein ins rollen.
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 9
Horst Schreiber stieß 2010 mit seinem Buch Im Namen der Ordnung die Auseinandersetzung mit der Tiroler Heimgeschichte an, das auch von Betroffenen immer wieder in den im Rahmen dieser Studie durchgeführten Interviews erwähnt wurde: Die Bedeutung dieses Buchs ist daher nicht nur eine gesellschaftliche und wissenschaftliche, sondern auch eine individuelle. Denn Schreiber gelang es damit, vielen ehemaligen Heimkindern zu verdeutlichen, dass sie nicht allein mit ihren Erfahrungen und Erinnerungen sind. Auch das fünf Jahre später folgende Restitution von Würde des Historikers setzt sich mit der Thematik der Heimerziehung, diesmal mit Fokus auf die Kinderheime der Stadt Innsbruck, auseinander.
Die PHOENIX Dokumentation “Missbraucht und misshandelt – Skandal in Österreichs Kinderheimen” vom 20.02.2013 zeigt sehr eindrücklich das erschreckende Ausmaß der systematischen Misshandlung von Heimkindern in Österreich.
Was in den 30 Jahren seit der ORF-Dokumentation “Problemkinder” von 1980 passiert ist.
Und was nicht.
2016: Staatsakt 'Geste der Verantwortung'
Als eine der Betroffenen luden Staat und Kirche Brigitte Wanker zu einem Staatsakt am 17.11.2016 im Parlament ein. Dort baten das Land Tirol und die katholische Kirche öffentlich um Verzeihung für die Missstände in den Heimen.
Mit dem Staatsakt im Historischen Sitzungssaal des Parlaments unter dem Titel "Geste der Verantwortung" wollten die Kirche und das offizielle Österreich das Unrecht anerkennen, das Heimkinder in den vergangenen Jahrzehnten in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen erlitten haben. Zentraler Programmpunkt waren Berichte von Betroffenen, die stellvertretend für das Schicksal tausender Kinder in staatlichen und kirchlichen Heimen standen. Vorgetragen wurden sie von den Schauspielern Karl Markovics, Regina Fritsch, Wolfgang Böck, Florian Teichtmeister und Miriam Fussenegger.
(Quelle: Katholische Kirche Österreich)
Das offizielle Österreich und die Kirche wollen mit dieser "Geste der Verantwortung" zum Ausdruck bringen, dass die Republik das unfassbare Leid von ehemaligen Heimkindern, die in der Zweiten Republik schweres Unrecht erlitten haben, mitsamt seiner lebenslangen Konsequenzen anerkennt und Lehren daraus gezogen hat.
(Quelle: parlament.gv.at)
Zitate aus dem Staatsakt:
“Als zum ersten Mal laut und deutlich von kirchlichem Missbrauch die Rede war, ich gestehe es, habe ich das als böse Erfindung der Medien empfunden, bis ich sehr bald gemerkt habe, erfahren habe, durch Gespräche, durch Begegnungen: Es ist bittere Wahrheit. Und es hat mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überzeugung gebracht: Nur eines hilft: die Wahrheit.”
Bundesratspräsident Mario Lindner
“Es sind Erlebnisse und Berichte, an denen es nichts zu beschönigen, nichts wegzureden gibt. Es sind Zeugnisse für eines des dunkelsten Kapitel in unserer Nachkriegsgeschichte.
Ein Staat hat eine zentrale Verantwortung – die Rechte und die Würde aller Menschen zu verteidigen, die in seinem Schutz leben. Das gilt umso mehr für die verwundbarsten Mitglieder seiner Gesellschaft. Für Kinder. Für Jugendliche.
Österreich hat bei Ihrem Schutz versagt. Unsere Institutionen haben versagt. Unsere Länder. Wir sind zu Mitwissern und Komplizen geworden.”
Nationalratspräsidentin Doris Bures
“Manchmal sucht man nach Worten, aber man findet nur Tränen. Diese Sprachlosigkeit müssen wir heute überwinden, um zu benennen, was tausende junge Menschen in unserer Obhut erleiden mussten. Über Jahrzehnte hinweg, inmitten unserer Gesellschaft, inmitten unserer Republik.
[…]
Leugnen, Verdrängen, Vergessen – das waren die Bausteine der hohen Mauer, die unsere Gesellschaft vor diesen Menschen errichtet hat. Erst vor wenigen Jahren hat diese Mauer Risse bekommen. Das ist vor allem das Verdienst jener Frauen und Männer, die über das Erlebte gesprochen und hartnäckig dafür gekämpft haben, dass ihnen geglaubt wird.
[…]
Es liegt leider nicht in unserer Macht, Missbrauch und Gewalt durch einzelne Täter für immer zu verhindern. Was aber in unserer Macht und in unser aller Verantwortung liegt, ist, zu verhindern, dass Missbrauch und Gewalt – wie einst – still geduldet, systematisch vertuscht und kollektiv geleugnet werden. Das Versagen darf sich nicht wiederholen. Nicht heute, nicht morgen – nie wieder!”
Starke und unverblümte Worte der höchsten Instanzen von Kirche und Staat. Ein erster Schritt, wie sie alle betonten.
Was wurde aus diesem Versprechen?
Die Mauer fällt. Die Steine bleiben.
Es hat sich viel getan seit Brigittes Erfahrungsbericht “Mauern überall” von 1980. Es gab ein Umdenken in den Heimen, ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung, Einmal-Zahlungen als Geste des Bedauerns (durchschnittlich €10.000 - €25.000), monatliche Renten (aktuell rund €400 monatlich) und Übernahme von Therapiekosten für die Opfer.
Eine gerichtliche Aufarbeitung und vollumfassende Entschädigung scheitert an der Verjährung.
Die Mauern fallen. Aber die Steine bleiben vielerorts noch liegen und blockieren den Weg.
Hier ein paar Beispiele:
Im Rahmen des Staatsaktes 2017 bemühte sich Brigitte Wanker um einen Dialog mit den Verantwortlichen.
Zeitschrift Menschen, 06/2017:
Sie bemühte sich 2012 um ein Aussöhnungsgespräch mit der Kirche. Der damalige Tiroler Bischof Manfred Scheuer und Generalvikar Jakob Bürgler erklärten sich dazu gerne bereit. Nur ein Stuhl blieb bei diesem Treffen leer, erinnert sich Wanker: „Die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern verweigerte die Teilnahme.“ Bischof Scheuer habe sich darüber sichtlich entsetzt und berührt gezeigt, sagt Wanker. „Der Bischof musste mir von der Generaloberin ausrichten, dass sie sich weigere, mit mir an einem Tisch Platz zu nehmen.“ Scheuer und Bürgler bedauerten dies glaubhaft, hätten aber keinerlei Handhabe gegen dieses Verhalten, wurde Wanker erklärt.
Bis heute verweigert das Heim der Barmherzigen Schwestern jeden Kontakt zu Brigitte Wanker. Ein klärendes Gespräch fand nie statt.
Diese Muster zeigen sich auch, wenn es um die Entschädigung der Opfer geht.
Zeitschrift Menschen, 06/2017:
Denn eine Recherche zu den seit 2011 namentlich bekannten Opfern hat ergeben, dass bis heute nur ein einziger Fall aus dem Heim der Barmherzigen Schwestern vor der kirchlichen Klasnic Kommission landete. Er sei jedoch als „minder schwer“ beurteilt worden, es wurde keine Entschädigung zuerkannt, aber Therapieleistungen übernommen. Nachfragen bei den Kommissionen des Landes Tirol und der Diözese Innsbruck haben gezeigt, dass keine weiteren Fälle aus Mils gemeldet wurden. Die Betroffenen müssten selbst tätig werden und sich bei den Kommissionen melden, was den meisten aber nicht möglich ist, da sie aufgrund ihres Zustandes nicht dazu in der Lage sind.
Auch hier zeigte sich der Orden wenig kooperativ:
Zeitschrift Menschen, 06/2017:
Die heutige Heimleitung und der Orden sprechen nur ungern über das Thema. Die Anfrage, ob und wie viele ehemalige Kinder der Einrichtung entschädigt wurden, wird mit einem lapidaren „Ansprüche der Opfer wurden von der Opferschutzkommission behandelt und die Opfer entsprechend entschädigt“ beantwortet. Nachfragen, wie viele Opfer und von welcher Kommission, blieben unbeantwortet. Man mauert und schweigt.
2020 gaben Land und Kirche eine zweijährige Studie in Auftrag: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945 von MMag.a Dr.in Ina Friedmann und Mag. Friedrich Stepanek. In dem 389 Seiten starken Werk berichten die Autor*innen ebenfalls über diese Mauerreste und Steine.
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 9
Das Thema katholische Kinderheime und dortige Lebensumstände im 20. Jahrhundert ist auch heute noch ein sehr sensibles, und zwar nicht allein für ehemals dort lebende Männer und Frauen. Auch Vertreter*innen jener Einrichtungen, die das Funktionieren der Institutionen und ihre Beteilung mit Minderjährigen gewährleisteten, versuchen die jeweilige Involvierung in die damaligen Zustände abzuschwächen. Etwa indem versucht wurde, die Zuweisung von Mädchen nach Martinsbühel durch die Jugendfürsorge als „Einzelfälle“ oder die dort wirkenden Ordensfrauen als die eigentlichen Opfer darzustellen, zeigt sich die kaum vorhandene Übernahme von Verantwortung und das wenig existente Verständnis für ehemalige Fürsorge- und Fremdunterbringungsrealitäten.
[…]
Umso problematischer ist es, dass sich ‚hinter verschlossener Tür‘ offenbar nur wenig verändert hat, wenn es um Wahrnehmung und Belange von ehemaligen Heimkindern geht. Ob die Fürsorge in ihr Leben involviert war oder nicht und auch wenn sie mittlerweile zum Teil organisiert sind, fehlt ihnen eine laute und vor allem gewichtige Lobby, die für sie eintritt. Mit welchen Hürden sie durch ihre Heimvergangenheit in unterschiedlichen Lebensphasen konfrontiert waren und sind, wird in diesem Bericht angesprochen. Dass manche von ihnen auch heute noch fürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird, ebenso.
Denn breite Akzeptanz von einstigen Missständen sowie Anerkennung von Misshandlungs- und Missbrauchserfahrungen besonders in konfessionell geführten Einrichtungen ist bis heute nicht vorhanden, obwohl in den vergangenen zehn Jahren eine erste Welle der Aufarbeitung eingesetzt hat.
Die Studie selbst ist ein immens wichtiger Schritt, zugleich aber für den Umfang der nötigen Aufarbeitung nicht mit den nötigen Mitteln oder genug Zeit ausgestattet:
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 9
Auch die vorliegende Studie versteht sich als Grundlage: Für weitere Forschungen zu den vielen Aspekten, die hier nur angeschnitten, jedoch nicht detailliert werden können. Ausschlaggebend dafür war die Projektlaufzeit von nur zwei Jahren zur Auseinandersetzung mit sieben katholischen Einrichtungen, die mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle durchgeführt wurde.
Einblick in das heutige St. Josef Institut gewährt die Studie unter anderem durch Leo Matuella, der ab 2005 für zehn Jahre in St. Josef als Leiter und Lehrer an der dort angeschlossenen Sonderschule tätig war. Er betont, wie angenehm die Arbeitsatmosphäre war und wie die ehemalige Schulleiterin, Sr. Evamaria, stets unterstützend war. Es gab einen guten und regelmäßigen Austausch zwischen dem Heimleiter, der Sr. Oberin des Heims und ihm als Schulleiter über die Schüler*innen.
Aber auch hier zeigen sich die Steine:
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 106
Leo Matuella erzählt von den positiven Veränderungen wie Sportprogrammen oder mehr Entscheidungsmöglichkeiten in der Beschäftigung, weg von verpflichtenden Tätigkeiten in den Werkstätten. „Das hat halt sehr geglänzt, aber es ist auch nicht alles Gold was glänzt“, sagt der Gesprächspartner in diesem Zusammenhang, denn „de facto haben sie ja wieder nichts dafür gezahlt bekommen [bezugnehmend auf ‚Taschengeld‘ statt Lohn in Werkstätten] und sind doch wieder in diese neue Abteilung hineingeschoben worden.“ Die Motivation des Personals war da, erklärt Herr Matuella, doch in einem derart großen Träger wie dem Orden wären tiefgreifende Veränderungen „nur peu à peu“ umzusetzen.
Und dann war da noch diese Anekdote über einen alten Käfig, der Sinnbild ist für den Umgang mit der Vergangenheit:
Studie: Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945, S. 106
Eine Begebenheit, die Interviewpartner Leo Matuella auch nach etwa zehn Jahren noch beschäftigt und die sein „Vertrauen in die Einrichtung erschüttert“ hat, ist das Auffinden eines Käfigs aus massiven Holzstäben von etwa 1mx1mx1,5m auf dem Dachboden, wo auch die früheren Anstaltsbetten, konkret Gitterbetten, aufbewahrt wurden. Vorweg ist festzuhalten, dass dieser Käfig verstaubt und alt war, also zweifellos aus früheren Jahrzehnten stammte, wie er selbst sagt. Keineswegs hat oder hatte er den Verdacht, dass dieser im aktiven Einsatz stand oder rezent verwendet worden war. Er fragte aus Neugier daraufhin beim Heimleiter nach, was es denn damit auf sich habe, der dies allerdings auch nicht wusste und weitere Erkundigungen einholte. Daraufhin sei eine höhere Ordensfrau zu ihm gekommen und erklärte ihm, dass es vor vielen Jahren einen Papagei im Haus gegeben habe und es sich vermutlich um dessen Käfig handelte, anders könne sie sich das nicht erklären. Herrn Matuella erschien der Käfig eigentlich nicht wie ein Vogelkäfig, weshalb er ihn am nächsten Tag nochmal betrachten und fotografieren wollte – das war jedoch nicht möglich, da der Käfig bereits entfernt worden war. Auch auf mehrmalige Nachfrage bei unterschiedlichen Personen konnte ihm „niemand schlüssig erklären, wo der Käfig hingekommen ist.“ Wie mit seinem Fund und seinen Fragen umgegangen wurde, war für den Gesprächspartner nicht befriedigend und hinterließ einen Beigeschmack.
Diesen Beigeschmack haben viele der Betroffenen bis heute.
2024: Die Tiroler Ehrung am kirchlichen Hohen Frauentag
Am 15.08.2024 erhält Brigitte Brinkmann-Wanker die Verdienstmedaille des Landes Tirol. Das Zeichen dafür, dass ihre Zivilcourage von 1980 nicht nur richtig, sondern gewünscht, ja, auszeichnungswürdig ist.
Ein weiteres, wichtiges Signal von der Instanz, die Brigitte damals zum Flüchtling im eigenen Land machte. Eine weitere Mauer fällt.
Noch bleiben viele Trümmer. Brigittes Hoffnung ist, dass der gute Weg, der seit 2010 beschritten wurde, konsequent zu Ende gegangen wird. Zum Wohle der Kinder von heute und damals. Und jener unbequemen Menschen, den schwächsten der Gesellschaft, die über Jahrzehnte vor dem Blick der Öffentlichkeit weggesperrt und unmenschlich misshandelt wurden.
Dass auch die letzten Mauerreste und Steine beseitigt werden, in den Systemen und in unseren Köpfen.
Nationalratspräsidentin Doris Bures:
Das Versagen darf sich nicht wiederholen.
Nicht heute, nicht morgen – nie wieder!
Nachwort von Hartmut Brinkmann,
Präsident des Kulturvereins “Kulturschmiede Kaiserwinkl”
Zu Kultur zählt eigentlich alles, was vom Menschen geschaffen oder gestaltet wurde. Auch die Art und Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist, gehört dazu. Ein Grundpfeiler des demokratischen Zusammenlebens ist die Grundrechtecharta der EU.
“Die Würde des Menschen ist unantastbar” steht an erster Stelle.
All diese Artikel wurden in Fürsorge-Einrichtungen gebrochen, und mit ihnen die Schutzbefohlenen.
Artikel 1
Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.Artikel 3
Recht auf Unversehrtheit
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.Artikel 4
Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.Artikel 20
Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.Artikel 24
Rechte des Kindes
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern.
In diesem Kontext ist das ganze Geschehen unfassbar. Da wurden Kinder und Schutzbefohlenen gequält, missbraucht und gefoltert. Seelen verletzt und unheilbar zerstört. Und das unter der Aufsicht von Staat und Kirche, verdeckt hinter Mauern und unter dem Mantel des Schweigens.
Und da sind Frauen und Männer die Zivilcourage und Mut aufbringen, Missbrauch und Gewalt aufzudecken. Für diese Personen ist von entscheidender Bedeutung, dass sie geschützt werden, um sicherzustellen, dass sie keine Repressalien oder Verfolgung erleiden müssen. Doch die Realität, wie der vorliegende Fall zeigt, sieht anders aus. Der Würde beraubt, in tiefster Seele verletzt, werden diese Personen von der Gesellschaft, den verantwortlichen Organisationen diffamiert, gejagt und alleingelassen.
Beide, Staat und Kirche haben nach dem Motto gehandelt, „was nicht sein darf, nicht sein kann“. Jetzt, nach 44 Jahren der Verschleppung und Verjährung, hat zumindest die Landesregierung die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Die Verleihung der „Verdienstmedaille“ kann nur ein kleines Pflaster auf viele noch offene Wunden sein.
Wer auch diesmal unbeachtet bleibt sind die Kinder und Schutzbefohlenen, diejenigen die die größten Wunden an Leib und Seele erfahren haben und noch heute mit sich tragen.
Mein Fazit. Der ärgste Feind des Menschen ist der Mensch. Deshalb sollte jeder Mensch dieser unverrückbare Satz der EU-Charta ernst nehmen und dafür einstehen. Brigitte Brinkmann-Wanker ist für mich, für uns mit ihrem Einsatz für die Schwachen der Gesellschaft, und ihrem Mut und ihrer Zivilcourage, ein großes Vorbild. Ich bin stolz sie als führendes Mitglied in unserem Verein zu haben.
Hartmut Brinkmann
Links und Quellen
Brigitte Wanker (1980), Archiviert in der Universität Innsbruck
“Mauern überall” - Erlebnisbericht aus dem Pflegeheim St.Josefs-Institut in Mils/Tirol
ORF (1980)
Reportage “Problemkinder” aus der Sendung “Teleobjektiv”
amazon.de (01.11.2010)
Buch “Im Namen der Ordnung. Heimerziehung in Tirol” von Horst Schweiger
heimerziehung.at
Heimkinder erzählen - Auszug aus dem Buch “Im Namen der Ordnung” von Horst Schreiber
hpd (02.06.2010)
Geschichte einer geraubten Kindheit
OÖ Nachrichten (09.05.2011)
Wiedersehen der Leonsteiner Heimkinder
Blog vom ehemaligen Heimkind Erwin Aschenwald (bis 2012)
Erziehung gestern - Geschichten aus der Bubenburg in Fügen - einem Kinderheim des Kapuzinerordens im Lichte der aktuellen Gewalt- und Missbrauchsdebatte, unter besonderer Berücksichtigung des Umganges mit Betroffenen durch öffentliche und kirchliche Opferschutzeinrichtungen.
KURIER (19.10.2012)
Tirol: Heimkinder um Spenden betrogen?
PHOENIX (21.02.2013) (YouTube)
„Missbraucht und misshandelt – Skandal in Österreichs Kinderheimen“, Dokumentarfilm
KURIER (12.07.2013)
„Die Landesverräterin“
Universität Innsbruck (21.07.2015)
Gesamtstudie zur Geschichte der Fürsorge- und Heimerziehung präsentiert
Tiroler Tageszeitung (Archiviert auf BishopAccountability.org) (21.01.2016)
Land hat Heimopfer „billigst abgespeist“
profil (21.06.2016)
Wir Heimkinder klagen an
Katholische Kirche (17.11.2016)
Staatsakt: Bitte um Vergebung
Wortlaut der Rede von Kardinal Christoph Schönborn beim Staatsakt "Geste der Verantwortung"
Parlament Österreich (17.11.2016)
Staatsakt "Geste der Verantwortung" kommt langjähriger Forderung der Betroffenen nach
Linkliste mit u.a. den Transkripten der Reden
Zeitschrift “Menschen” (Heft 06/2017)
Behinderte Heimopfer – die Geschichte wiederholt sich
STANDART (03.07.2017)
Kritik an sinkender Entschädigung der Heimopfer in Tirol
SALTO (24.06.2018)
Über die Grenze in die Psychiatrie
ORF (15.10.2020)
Land stärkt Rechte der Missbrauchsopfer
KRONE (19.09.2021)
Martinsbühel: Die Heimkinder schweigen nicht mehr
STUDIE (2020-2022)
Demut lernen. Kindheit in konfessionellen Kinderheimen in Tirol nach 1945
ORF (07.09.2022)
Missbrauch in Heimen: Glettler sieht „Totalversagen“
New Yorker (25.09.2023)
Behind a Locked Door
Tiroler Tageszeitung (08.08.2024)
Land Tirol ehrt „Lügnerin“ für ihre Zivilcourage
Land Tirol
Hoher Frauentag 2024
Presseliste Verleihung Verdienstmedaille 2024 (1 MB)